Der unbequeme Polenadvokat
Am 2. Mai 2020 starb Stefan Hambura.
Sein Markenzeichen war die nach oben offene Maulwurfbrille mit dem seltsam geschwungenen Designergestell. Stefan Hambura war Anwalt mit einem gewissen Hang zur Selbstdarstellung und ein Störenfried. Er wurde nicht müde durch sein Poltern die institutionellen Tretmühlen der polnisch-deutschen Verständigung aus dem Takt zu bringen. Er riss das Pflaster ab, mit dem sie die wunden Stellen im polnisch-deutschen Verhältnis zu kaschieren versuchten.
Kein Wunder, dass sich in beiden Ländern die Trauer nach seinem plötzlichen Tod stellenweise sehr in Grenzen hielt. Vor allem dort, wo man in Ministerien, Botschaften, Konsulaten, Austauscheinrichtungen, an wissenschaftlichen Instituten für die polnisch-deutschen Beziehungen verantwortlich zeichnet und meistens nur seine Ruhe haben möchte. Dort galt Hambura als ein lästiger Quälgeist. Er störte die Routine. Regelmäßig brachte er die Versöhnungs-Bürokraten in Erklärungsnöte, zwang sie zum Tätigwerden in Bereichen, die sie geflissentlich übersahen, in denen man sich keine Meriten erwerben, dafür aber sehr schnell die Finger verbrennen konnte.
Dazu verkörperte Hambura geradezu mustergültig ein Paradoxon, das immer wieder mal vorkommt und stets für Verwirrung sorgt. Ein Deutscher aus Polen wurde zu einem polnischen Patrioten in Deutschland. Seine Gegner schimpften ihn gar einen polnischen Nationalisten.
Der Deutsche in Polen
Als Stefan Hambura 1961 in Gleiwitz auf die Welt kam, hieß die Stadt schon seit sechzehn Jahren, seit 1945, Gliwice. Vor dem Zweiten Weltkrieg lag sie auf der deutschen Seite, direkt an der Grenze, die Oberschlesien in einen deutschen und in einen polnischen Teil spaltete. Hier täuschten die Nazis am Abend des 31. August 1939 den „polnischen Bandenüberfall auf den Sender Gleiwitz“ vor, der ihnen den Vorwand zum Einmarsch in Polen liefern sollte.
In der viertgrößten Stadt Oberschlesiens wohnten in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts, trotz der Flucht vor der Roten Armee und trotz aller Aussiedlungen unmittelbar nach dem Krieg, immer noch nicht wenige Deutsche, nun mit polnischer Staatsangehörigkeit. Die Familie des Buchhalters Hambura gehörte dazu.
Unter den Nachbarn der Hamburas gab es immer mehr zugezogene Polen aus anderen Landesteilen, mit ihren eigenen Kriegserlebnissen. Auf Deutsche und Deutschland war man in Gliwice, wie anderswo, nicht gut zu sprechen, und die kommunistischen Behörden trugen dazu wesentlich bei.

Deutsch als Fremdsprache wurde damals in diesen Gegenden an den Schulen grundsätzlich nicht unterrichtet. Stefan und sein Bruder sprachen den polnisch-oberschlesischen Dialekt, die „godka“, in dem nicht wenige Germanismen vorkommen. Aber wenn die Eltern wollten, dass die Kinder nicht verstehen sollten worüber sie redeten, dann sprachen sie Deutsch. Einige Male setzte der Vater dazu an, den Söhnen Deutsch mit Hilfe eines Fremdsprachenlehrbuchs beizubringen. Spätestens aber nach zwanzig Lektionen schlief die Sache in der Alltagsroutine wieder ein, so die Erinnerung des Anwalts Hambura an seine Kindheit.
Jedes Mal wenn beide Söhne in eine Kinder-Sommerfreizeit fuhren, beschworen sie die Eltern: „Auch wenn euch die Erzieherinnen Bonbons geben und gut zureden, sagt lieber nicht, dass wir nach Deutschland wollen“. Doch das war ohnehin bekannt. Seit Mitte der Sechzigerjahre reichten die Hamburas einen Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik nach dem anderen ein, „zwecks Familienzusammenführung“.
Europa war damals gespalten, der Eiserne Vorhang sehr dicht. Im kommunistischen Polen galt zu dieser Zeit schon die offizielle Auslegung, dass es, bis auf wenige Ausnahmen, keine Deutschen mehr im Land gäbe. Sie seien 1945 vor den Sowjets geflohen oder zwischen 1945 und 1949, gemäß dem Potsdamer Abkommen, zwangsweise ausgesiedelt worden. Überdies gab es die Spätaussiedlerwelle zwischen 1955 und 1959, als im Zuge des politischen Tauwetters nach dem Ende des Stalinismus noch einmal knapp 300.000 Deutsche das Land verlassen durften.
Der Rest, konzentriert vor allem im Oppelner- und im oberschlesischen Raum, das waren, nach offizieller Lesart, „Autochthone“ (= Alteingesessene). Es galt, sie in die polnische Nation, durch Kindergarten, Schule, Militär, Arbeitsplatz, „nach Jahrhunderten der Germanisierung“, wieder einzugliedern. Bei der jungen Generation zeigte dieses Vorhaben im Laufe der Zeit durchaus Erfolge.


Die Kinder und Jugendlichen sprachen ja fließend polnisch und die Welt ihrer polnischen Altersgenossen war, oft zum Leidwesen der Eltern und Großeltern, ganz und gar die Ihre. Die sprachliche und bewusstseinsmäßige Anpassung der Kinder an die polnische Umgebung war eine Tatsache, der sich Vater Hambura mit seinem Deutsch-Heimunterricht mit wenig Erfolg zu widersetzen versuchte. Das verstärkte bei den Älteren generell die Neigung zur Umsiedlung, ehe ihnen die Jüngsten womöglich ganz und gar ins Polnische entglitten.
Der Traum vom goldenen Westen
Eins jedoch machte die Eingliederung in Polen schwierig, oft gar unmöglich. Es galt sich in die Welt des Kommunismus einzufügen, in der es weder Wohlstand noch Freiheit gab. Beides verhieß aber das Wirtschaftswunderland Bundesrepublik, in dem auf jeden, der seine deutsche Herkunft nachweisen konnte, der deutsche Pass und die üppigen Segnungen des Wohlfahrtsstaates warteten.
Folglich war der Drang, dorthin zu gelangen, enorm, doch das kommunistische Polen wollte dieses zehntausendfache Misstrauensvotum seiner „Autochthonen“ aus Prestige- und aus wirtschaftlichen Gründen nicht hinnehmen. Schließlich waren es oft teuer ausgebildete Ingenieure, Techniker, Facharbeiter, Mediziner, die weggehen wollten. Stefan Hambura zum Beispiel machte eine Lehre zum Fernmeldetechniker.
Wer also einen Ausreiseantrag stellte, musste auf Entlassung, den Verlust beruflicher Aufstiegsmöglichkeiten, auf Verwaltungsschikanen gefasst sein. Manche schreckte das ab. Viele nahmen es hin und stellten immer wieder neue Ausreiseanträge.
Antikommunistisch und fest im katholischen Glauben verankert, die Hamburas waren in dieser Hinsicht keine Ausnahme unter ihresgleichen. Stefan war Messdiener und beim Religionsunterricht eifrig dabei. Seitdem die Kommunisten 1961 die Katechese endgültig aus den Schulen verbannt hatten, durfte sie nur nachmittags in den Kirchen stattfinden.
Eltern, die ihre Kinder dort hinschickten, legten in den Augen der Kommunisten ein eindeutiges politisches Zeugnis ab. Auch das blieb oft nicht ohne Folgen, in einem totalitären Staat, der alles nach seinem Gutdünken zuteilen oder verweigern konnte: eine Wohnung, einen Reisepass, einen Kindergarten- oder einen Studienplatz, eine Kur oder ein Telefon zu Hause, auf das man normalerweise bis zu zwanzig Jahre lang wartete, aber mancher „Verdiente“ bekam es eben schneller.
Angekommen
Stefan Hambura hob im Familienarchiv sorgfältig sein Tagebuch des Religionsschülers auf, in dem Pfarrer Kazimierz Mol die Anwesenheit in jeder Unterrichtstunde mit Unterschrift und Stempel bestätigte. Die letzte Bestätigung fiel auf den 5. Dezember 1978. Am 12. Dezember sollte das Thema lauten „Der Herr ist nahe“. Da aber waren die Hamburas schon im niedersächsischen Friedland angekommen, dem Erstaufnahmelager für Spätaussiedler.
Nach gut zehn Jahren des Antragstellens in Gliwice durften sie endlich raus. Ihr Weg führte sie weiter ins NRW-Aussiedlerlager Unna-Massen. Dort galt es einige Monate lang abzuwarten, bis alle Formalitäten erledigt, eine Wohnung, die Schule für die Söhne, ein Job für den Vater gefunden waren. Für die beiden jungen Hamburas und ihresgleichen war in Unna-Massen ausgiebiger Deutsch-Unterricht angesagt. In den Pausen aber, so Stefans Erinnerung an diese Zeit, wurde nur Polnisch oder Russisch gesprochen.
Er war fleißig, ehrgeizig, wissbegierig und die technische Mittelschule, in die Stefan Hambura in Polen gegangen war, kann auch nicht schlecht gewesen sein, wenn er problemlos am Gymnasium in Duisburg, wo sich die Familie niederließ, aufgenommen wurde, das Abitur bestand und das Jurastudium an der Bonner Universität bewältigte. Dazwischen lag noch ein Jahr Pflicht-Wehrdienst bei der Bundeswehr.
In all diesen Jahren lernte der Deutsche aus Polen am eigenen Leibe die Geringschätzung kennen, die den Polen in Deutschland oftmals entgegengebracht wird. Man hielt ihn für einen von ihnen. Dort, wohin die politische Korrektheit nicht vordringt: auf dem Schul- und auf dem Kasernenhof, in der Soldatenstube, beim Kommilitonen-Gelage, bei den Aushilfsjobs, mit denen er sich das Studium mitfinanzierte, sparte man ihm, dem vermeintlichen Polen gegenüber, nicht mit Sticheleien, Spott, Hohn, Herabsetzung.
Am Beginn seiner Verteidiger-Laufbahn versuchte Hambura, der sein tägliches Brot mit Zivil- und Wirtschaftsfällen verdiente, sich ebenfalls als Anwalt von Vertriebenen und Spätaussiedlern zu etablieren. Im Jahr 2003 vertrat er eine Deutsche aus Dortmund, die ihr Wohnhaus in Gliwice zurückbekommen und verkaufen wollte. Weder dieses noch einige weitere, ähnliche Mandate, die er übernahm, waren von Erfolg gekrönt.
Außerdem hatten die Flüchtlinge und Spätaussiedler noch in den Neunzigerjahren sowie um die Jahrtausendwende genügend, weit mächtigere Fürsprecher: den politisch einflussreichen Bund der Vertriebenen (BdV), die Landsmannschaften, Vertriebenen-Politiker, wie Herbert Czaja, Herbert Hupka, Erika Steinbach, Hartmut Koschyk oder solche, die ihnen politisch den Rücken stärkten, wie Alfred Dregger, jahrelang Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und der prominenteste Vertreter der nationalkonservativen CDU-„Stahlhelm-Fraktion“. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl legte lange Zeit, wenn nicht Sympathien, so auf jeden Fall Respekt vor den Vertriebenen an den Tag. Die zwei bis drei Prozent Stimmen, die bei ihnen noch Anfang der Zweitausenderjahre zu holen waren, konnten wahlentscheidend sein.
Fachmann für hoffnungslose „Polen-Fälle“
Teilweise ganz ohne eigenes Zutun öffnete sich derweil vor dem Anwalt Hambura eine „Marktlücke“, die seine deutschen Kollegen ohne polnischen Hintergrund nicht abzudecken vermochten. Dazu bedurfte es nicht nur bester Polnischkenntnisse, sondern einer besonderen Feinfühligkeit, die auf Anhieb Vertrauen erzeugt.
Anwälte gab und gibt es in der Bundesrepublik mehr als genug, aber in dieser besonderen Kategorie agierte Stefan Hambura am Anfang weitgehend allein auf weiter Flur. Inzwischen gibt es in Hamburg, Berlin, Köln Sozietäten mit polnischsprachigen Anwälten, die sich solcher Fälle annehmen.
Die Polen, die bei ihm landeten, waren oft einfache, schwer arbeitende Leute, die nicht viel Deutsch sprachen, unversehens in die Mühlen der deutschen Bürokratie gerieten und oft weder ein noch aus wussten. Hambura wurde so zum bekanntesten Fachmann für vertrackte und hoffnungslose „Polen-Fälle“.
In jener Zeit war er schon einige Jahre verheiratet mit Grażyna, einer Polin die er in Bonn in der Kirche kennengelernt hatte. Sie arbeitete als Kirchenjuristin im Erzbistum Köln und gab ihre Stelle auf, als die Familie in die neue-alte Hauptstadt Berlin zog, wo sich der Anwalt mehr Chancen auf beruflichen Erfolg ausmalte. Sie hat die polnische, er hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie sprach mit den beiden Kindern, die zwei Staatsangehörigkeiten haben, nur Polnisch, er nur Deutsch. „Damit in ihren Köpfen Ordnung herrsche“, so Hambura in einem Zeitungsgespräch.
Zu ihm kamen vor allem polnische Elternteile, die sich nach Scheidungen von deutschen Partnern benachteiligt fühlten, weil deutsche Behörden grundsätzlich nur deutschen Müttern bzw. Vätern das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder übertragen. Noch schwieriger und dramatischer waren und sind die Wegnahmen polnischer Kinder durch Jugendämter in der Bundesrepublik. Diesen Behörden hängt der Ruf an, durch ihre oft rabiaten Praktiken, die Elternrechte auszuhebeln.
Lesen Sie dazu: „Deutsche Jugendämter, polnisches Leid“
Hungern und kämpfen für die polnische Minderheit
Eine zweite wichtige polnisch-deutsche Angelegenheit, der sich Hambura restlos verschrieben hatte, war, dabei zu helfen, dass die Polen in Deutschland den Status einer nationalen Minderheit zurückbekommen. Umso mehr, als die Deutschen in Polen diesen Status innehaben.
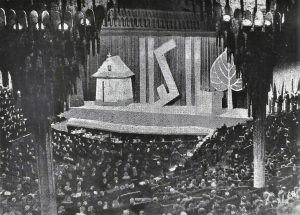
Die Polen waren als nationale Minderheit in Deutschland bis zum 7. September 1939 anerkannt. Unmittelbar nach dem Überfall auf Polen hatte Hitler, per Führererlass, diese Anerkennung widerrufen und den Bund der Polen in Deutschland verboten. Am 3. Juni 1940 beschlagnahmte das Dritte Reich alle Immobilien, Bank- und sonstige Vermögen der polnischen Minderheitsorganisationen.

Etwa 2.000 ihrer Funktionäre und prominenten Mitglieder, allesamt deutsche Staatsbürger, wurden verfolgt, jeder zweite von ihnen überlebte die KZ-Haft nicht. Eine kollektive Rehabilitierung und Entschädigung per Gesetz, wie im Falle der Homosexuellen oder der Wehrmacht-Deserteure, fand nicht statt. Die bedauernde Erwähnung in der Entschließung des Bundestages vom 10. Juni 2011 musste ausreichen.
Bis heute weigert sich die Bundesrepublik beharrlich, Hitlers Beschluss rückgängig zu machen. Eine der Begründungen lautet, die Polen in Deutschland bewohnen kein zusammenhängendes Gebiet. Das tun die Sinti und Roma auch nicht, dennoch hat Deutschland ihnen 1998 den Minderheitenstatus zuerkannt, der auch den Dänen, den Friesen und den Sorben in Deutschland zusteht. Außerdem, so die offizielle deutsche Haltung, bestehe das Hauptproblem darin, dass fast alle Polen oder deren Vorfahren durch Migration in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelangt seien. Nicht viel anders verhält es sich mit den Sinti und Roma.

Der Minderheitenstatus verpflichtet die Bundes- und Landesverwaltungen die Pflege der Kultur und der Sprache der anerkannten Minderheiten fortlaufend zu finanzieren. Das geht aus internationalen Verträgen hervor. Da die Polen als Minderheit nicht mehr anerkannt werden, sind ihre Einrichtungen auf gelegentliche, nach freiem Ermessen gewährte, bescheidene und zeitbeschränkte Projektfinanzierungen aus verschiedenen Töpfen angewiesen. So kann man keine stabilen Strukturen aufbauen.

Anders die Deutschen in Polen, wo der Staat und die Kommunen allein das Schulwesen der deutschen Minderheit pro Jahr mit umgerechnet 14 Millionen Euro finanzieren. Dazu kommen noch einige weitere Millionen für die Kulturförderung.

Hambura wollte es genau wissen. Er forderte Akteneinsicht bei den deutschen Behörden. Ging in Archive, rekonstruierte das Geschehen um das Verbot der polnischen Minderheit von 1939 und die Enteignungen von 1940. Er brachte Fakten ans Tageslicht und ins öffentliche Bewusstsein.
Das war um 2008. Danach wurde knapp zehn Jahre lang verhandelt, getagt, polnischerseits gefordert, deutscherseits mal viel versprochen, mal abgewiegelt. Hambura war oft mit von der Partie, sah frustriert zu.

Am Ende tat er das, worin er ein Meister war. Er hängte die Sache an die ganz große Glocke. Zuerst schrieb er im Februar 2017 einen offenen Brief an Angela Merkel: „Seit dem Jahr 2009 gibt es kaum Fortschritte in den Fragen der Polnischen Minderheit in Deutschland. Ich möchte Sie, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, daher bitten, die Angelegenheit der Polnischen Minderheit in Deutschland zur „Chefsache“ zu erklären und diese schnellstmöglich zu lösen.“ Im Mai in Warschau und im Oktober 2017 in Berlin trat er dann in mehrtägige Hungerstreiks.
„Da muss man was machen“
Es hieß, Hambura trete zu theatralisch auf, wenn er etwas durchsetzen wolle. Nicht wenige störten sich, wie sie sagten, an seiner großtuerischen Art. Er wurde bezichtigt sich in Szene zu setzen aus rein geschäftlichen Überlegungen, gehöre doch das Klappern zum Handwerk.
Wer ihn näher kannte, der kannte auch seinen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und seinen fast schon reflexartigen Hang überall dort helfen zu wollen, wo er die elementare Fairness verletzt sah. „Da muss man was machen“, den Satz hat er oft wiederholt.

Viele seiner Mandate übte er umsonst aus. Zum Beispiel die von Kindern polnischer KZ-Häftlinge, die auf Entschädigung für psychische Leiden und materielle Nachteile klagten, die ihnen die Verfolgung und der Tod der Mutter oder des Vaters zugefügt hatten. Deutsche Gerichte haben alle diese Klagen abgewiesen. In seiner Bonner Zeit vermittelte Hambura schwer kranke polnische Kinder zu Operationen in deutschen Fachkliniken, sammelte Geld dafür und steuerte eigenes bei.
Hamburas Tatendrang schien unerschöpflich zu sein. Er war ein Hansdampf in den holprigsten, verwinkeltesten polnisch-deutschen Gassen. Jugendämter. Polnische Minderheit in Polen. Deutsche Reparationen für Polen. Die „Polnische Treuhand“ als Antwort auf die „Preußische Treuhand“, die von Polen Entschädigungen für das nach 1945 zurückgelassene deutsche Eigentum forderte. In Berlin, die Errichtung eines Dokumentationszentrums für polnisches Leid im Zweiten Weltkrieg als Antwort auf den Bau des von Erika Steinbach forcierten Zentrums „Flucht und Vertreibung“.

Stefan Hambura stand bei all diesen Initiativen an vorderster Front. Oft mit einem Megafon in der Hand, wie am 1. Oktober 2018 vor der deutschen Botschaft in Warschau, als viele Dutzend geladener Gäste, die Einladungen in der Hand, nach und nach durch das Eingangstor gelassen wurden, um am Empfang des Botschafters zum Tag der Deutschen Einheit teilzunehmen. Transparente und großformatige Fotos des zerstörten Warschau, wenige Meter vom Botschafts-Zaun entfernt, beeinträchtigten die Idylle des lauen Herbstabends an den kalten Buffets, genauso wie Hamburas Megafon-Ansprache über Deutschlands materielle und moralische Schuld gegenüber Polen.
Zwischen den Mühlsteinen der Politik
Kein Wunder, dass maßgebliche Personen und Institutionen in Deutschland, die sich mit Polen beschäftigen, Hambura mit hartnäckiger Nichtbeachtung straften. Nach ihm gefragt, sagte der Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt der Zeitung „Rzeczpospolita“, er glaube, Hamburas Tätigkeit sei nicht wichtig genug, um sie zu kommentieren.
Folglich war Hambura auch für sämtliche deutsche Medien in all den langen Jahren weitgehend ein Niemand. Als ihm, 2013, der „Spiegel“ ausnahmsweise einen Artikel widmete, hieß es, in Deutschland gelte Hambura als „so etwas wie der juristische Sachwalter der polnischen Nationalkonservativen. Geführt wird dieses Lager von Jarosław Kaczyński.“
Diese Beobachtung drängte sich durchaus auf, nur wäre es der Redlichkeit halber angebracht gewesen hinzuzufügen, wie und warum Hambura geradezu in diese Rolle hineingedrängt wurde. Alle anderen wichtigen politischen Kräfte in Polen wollten sich nämlich auf keinen Fall mit Deutschland anlegen.

Am wenigsten die Bürgerplattform des damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Er war und ist der politische Ziehsohn Angela Merkels, dem die Kanzlerin 2014 seinen Traum EU-Ratspräsident zu werden, als Gegenleistung für seine unverbrüchliche Deutschland-Treue, erfüllt hat.
Zwischen 2008, als die Tusk-Partei Bürgerplattform die vorgezogenen Parlamentswahlen gewann und Jarosław Kaczynski als Regierungschef abservierte, und Herbst 2015, als die Kaczyński-Partei Recht und Gerechtigkeit wieder an die Macht kam, war Hambura auch für das offizielle Polen ein Nobody. Polnische Botschaften und Konsulate in Deutschland, die der Anwalt um Amtshilfe für seine polnischen Mandanten bat, durften sich nicht mit ihm einlassen.
Genauso wie ihre deutschen Kontrahenten sahen die Tusk-Leute ebenso wenig eine Veranlassung all die heiklen Themen, die Hambura aufgriff auch nur zu berühren. Nichts und niemand sollte den angeblich blauen Himmel der polnisch-deutschen Versöhnung trüben.
Deutschen Politikern und Beamten gegenüber saß damals eine besondere Spezies polnischer Offizieller. Oft waren es einstige polnische Teilnehmer an gemeinsamen, gut dotierten Forschungs- und Austauschprojekten. Ehemalige, wohl entlohnte polnische Gastprofessoren an deutschen Universitäten. Vormalige polnische Praktikanten in deutschen Behörden, wie dem Bundestag, dem Auswärtigen Amt usw. Sie alle verdankten Deutschland einiges und hofften oft auf mehr.
Angetrieben durch deutsche Fördergelder drehte sich seit 1990 munter das Karussell der von Deutschland für die Polen konzipierten und bezahlten Konferenzen, Projekte, Austausche und Studienreisen. So schuf sich Deutschland seine Dialogpartner. Leute wie Hambura, die Sand ins Getriebe streuten, gehörten isoliert.
Blauäugig, wie er am Anfang war, suchte Hambura die Nähe dieser Leute. Er sah in ihnen die Sachwalter polnischer Interessen, so wie er es verstand. Die Lektion, die sie ihm erteilten war für ihn sehr bitter. „Anwalt Hambura, die stumme Glocke“, höhnte 2010 die „Gazeta Wyborcza“.
„Ein Jemand, wie der Anwalt Hambura, der aus welchen Gründen auch immer, sich als Deutscher erklärt hat, sollte nicht den Super-Polen spielen. Vielleicht sollte man in seiner Lage ein Europäer sein, der sich um Versöhnung bemüht, anstatt Gereiztheit zu schüren. Ich bin nicht der Meinung, dass ein deutscher Anwalt, wie Herr Hambura, ein Mitgestalter der polnischen Außenpolitik sein sollte, umso weniger, paradoxerweise, der einer Partei wie Recht und Gerechtigkeit“, so die 2010 geäußerte Meinung von Dr. Kazimierz Wóycicki, einst Direktor der polnischen Kulturinstitute in Düsseldorf und Leipzig und seinerzeit einer der Sprachführer der Deutschland-Politik Donald Tusks.

Hambura hat diese Verschmähungen bis in seine letzten Tage nicht verarbeitet.
Die Einzigen, die ihn ernst nahmen und zu schätzen wussten waren die Nationalkonservativen, also ließ er sich ein mit ihnen. Bei ihnen saß er in den Tagungspräsidien, hielt gut besuchte Vorträge, spürte Dankbarkeit und Zustimmung. In ihren Medien erklärte er den Polen Deutschland.
Diese Kontakte gingen auf Hamburas, mit der Zeit sehr eng gewordene, Bekanntschaft mit dem späteren Professor Mariusz Muszyński zurück. Sie entstand Ende der Neunzigerjahre, als Muszyński die Rechtsabteilung an der polnischen Botschaft in Berlin leitete. Hambura schrieb damals ab und an Gutachten für die Botschaft.

Muszyński, der aus seiner nationalkonservativen Gesinnung kein Hehl machte, erlebte einen kurzfristigen politischen Höhenflug zwischen 2005 und 2007, zur Zeit der ersten Regierung von Recht und Gerechtigkeit unter Ministerpräsident Jarosław Kaczyński. Muszyński wurde Berater der damaligen Außenministerin Anna Fotyga und Bevollmächtigter der polnischen Regierung für die, in jenen zwei Jahren eher angespannten, polnisch-deutschen Beziehungen.
Zwar wurde Muszyński Ende 2008, sofort nach der Machtübernahme der Regierung Donald Tusk, abgesetzt. Er blieb jedoch als Deutschland-Kenner der Mann, der die Deutschland-Sicht der in die Oppositions-Bänke verwiesenen Nationalkonservativen prägte. Er ist heute Richter am Verfassungsgericht.
Hambura übernahm Muszyńskis Agenda und Sichtweise der wunden polnisch-deutschen Punkte. Einige Male rief er Organisationen ins Leben, um seine Anliegen besser durchzusetzen. Da waren der Verband der durch Jugendämter geschädigten polnischen Eltern, eine Partei der Polen mit dem Namen Europäische Initiative in Deutschland, der Weltkongress der Auslandspolen. Die beiden ersten gingen bald ein. Den Weltkongress gibt es noch, aber seinem großen Namen ist er bis jetzt eher nicht gerecht geworden. Hambura fand keine Partner, denen er diese Strukturen anvertrauen konnte, von einer Dauerfinanzierung ganz zu schweigen.
Das Smolensk-Engagement
In Polen wurde er 2007 bekannt, als Anwalt von Anna Walentynowicz. Die Kranführerin von der Danziger Lenin-Werft ist neben Lech Wałęsa die wohl bekannteste Symbolfigur der Solidarność-Bewegung. Der Regisseur Volker Schlöndorff verarbeitete ihre Lebensgeschichte im Spielfilm „Strajk – Die Heldin von Danzig“, und zwar so, dass Walentynowicz ihren guten Ruf gründlich ruiniert sah, sollte der Film als ihr Portrait in die Kinos gelangen.


Dank Hamburas Vermittlung kam es zu einem Vergleich. Der Filmproduzent ließ verlautbaren, dass die Titelgestalt eine fiktive Person sei, für deren Darstellung man einige wenige Fragmente aus Walentynowiczs Vita herangezogen habe. Außerdem spendete die Produktionsfirma, wie von der zunehmend extrem kurzsichtigen Walentynowicz gefordert, 50.000 Euro für die Augenklinik der Medizinischen Akademie in Gdańsk.
Drei Jahre später, am 10. April 2010 kam Anna Walentynowicz bei der Flugzeug-Katastrophe von Smolensk ums Leben. Mit ihr fanden weitere 95 Menschen den Tod, darunter Polens Staatspräsident Lech Kaczyński, der Zwillingsbruder von Jarosław, und seine Ehefrau.
Man kannte sich bereits, und so bat Walentynowiczs Sohn Janusz Hambura erneut um juristischen Beistand.
Die Russen hatten die Leichen und Leichenteile der Verunglückten nach dem Absturz in Müllsäcke und dann in Stahlbehälter gepackt, diese verlötet und in Särge gelegt. Sie durften in Warschau nicht mehr geöffnet werden. Mit der Zeit kamen bei vielen Familien immer mehr Zweifel auf, ob in den Gräbern, die sie pflegen, tatsächlich ihre Angehörigen liegen.


Die Tusk-Regierung, die die Untersuchung der Katastrophe und das Flugzeugwrack den Russen überlassen hatte, wollte die Exhumierungen nicht zulassen. Hambura setzte sie für Janusz Walentynowicz und die Angehörigen des ehemaligen Dissidenten Stefan Melak, der ebenfalls mit an Bord war, durch.
Nach der Graböffnung stellte sich heraus, dass statt Walentynowicz ein anderes Opfer der Katastrophe unter ihrem Namen bestattet worden war. Es bedurfte weiterer Exhumierungen um ihren Körper zu finden. Knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem Tod, im September 2012, fand Anna Walentynowicz endlich ihre letzte Ruhe. Ihr Leichnam, so das Autopsie-Protokoll, wurde in Moskau, wohin die Toten aus Smolensk zuerst gebracht wurden, „geschändet“. In anderen Gräbern fand man „überschüssige“ Gliedmaßen, Köpfe.
Die Smolensk-Katastrophe beschäftigte Hambura erneut zwischen 2016 und 2019. Ein knappes Dutzend Familien der Smolensk-Opfer hatte vor dem Kreisgericht Warschau Privatklage gegen fünf Beamte aus der Umgebung von Donald Tusk erhoben, die seinerzeit mit der Vorbereitung des tragischen Fluges beschäftigt waren. Hambura vertrat dort abermals die Familien Walentynowicz und Melak, wieder einmal umsonst.

Als Vertreter der Kläger nahm er im Gerichtssaal, gemeinsam mit anderen Anwälten, u. a. den ehemaligen Ministerpräsidenten und damaligen EU-Ratsvorsitzenden Donald Tusk sowie den ehemaligen Außenminister Radosław Sikorski bei deren Befragung ins Kreuzfeuer. Sie zahlten es ihm mit gehässigen Kommentaren auf Twitter heim. Das Gericht verurteilte zwei der angeklagten Beamten zu zehn, beziehungsweise sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung. Sie waren die einzigen, die für diese Tragödie zur Verantwortung gezogen wurden.
Das Ende der Quirligkeit
Während dieses Prozesses erlangte der Berliner Anwalt in Polen eine Bekanntheit, die ihm in Deutschland niemals zuteil wurde. Daneben fand er noch Zeit um Vorlesungen an der Schule des deutschen Rechts der Juristischen Fakultät der Universität Warschau zu halten. Mit Prof. Mariusz Muszyński schrieb Hambura seit dem Jahr 2000 gemeinsam Bücher mit Kommentaren zu den EU-Verträgen. Seine Berliner Anwaltskanzlei ließ er dabei keinesfalls verwaisen.
Seine Quirligkeit versetzte Beobachter und Bekannte stets aufs Neue in Erstaunen. Freunde rieten ihm, sich zusätzlich als Zugschaffner ausbilden zu lassen. Er könnte sich so ein Zubrot verdienen. Der Berlin-Warszawa-Express, mit dem er unentwegt zwischen den beiden Hauptstädten pendelte, galt als sein zweites Zuhause.
Der tödliche Herzinfarkt, der ihn Ende April 2020 in Warschau ereilte, war der Preis für ein intensiv gelebtes, prallgefülltes Leben.
Bestattet wurde Stefan Hambura dort, wo er, der deutsche Anwalt aus Berlin, inzwischen auf jeden Fall hingehört: auf dem Powązki-Friedhof in Warschau, wo diejenigen ruhen, die sich Polen verschrieben haben.
© RdP