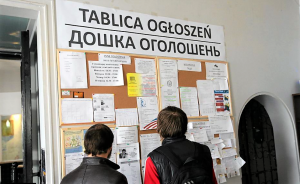16.05.2022. Medienfreiheit in Polen oder Reporter ohne (Scham)Grenzen
Jedes Jahr veröffentlicht die internationale Organisation Reporter ohne Grenzen (RoG) eine Rangliste der Medienfreiheit. Seit 2016 wird Polen darin regelmäßig immer weiter unten gelistet.
Dieses Mal belegte es den 66. Platz, den schlechtesten in der Geschichte des Rankings. Betrachtet man jedoch ausschließlich das politische Kriterium (es gibt auch ein juristisches, ökonomisches und soziokulturelles Bewertungsmerkmal sowie den Aspekt der Sicherheit für Medienschaffende), dann liegt Polen auf Platz 110 (von 180 aufgeführten).
Beim Umschalten zwischen den Kanälen mit der TV-Fernbedienung, beim Durchsuchen von Nachrichtenportalen oder beim Lesen einer Wochenzeitung ist uns nicht bewusst, dass Polen in Bezug auf die Meinungsfreiheit schlechter dasteht als Moldawien, Burkina Faso, Samoa, Sierra Leone, Tonga oder Niger. Dass die Slowakei (wo vor nicht allzu langer Zeit Journalisten auf Bestellung ermordet wurden) sogar 39 Plätze höher eingestuft wird. Aber Reporter ohne Grenzen sehen uns so.
Was geschah also in Polen im Jahr 2021? In dem Ranking werden nüchterne Indikatoren mit Urteilsbegründungen versehen. Und hier sind Worte sehr wichtig.
Laut RoG hat der staatliche Energiekonzern Orlen die zwanzig polnischen Regionalzeitungen, die bisher dem deutschen Verlagshaus Passauer Neue Presse gehörten, nicht für umgerechnet ca. 45 Millionen Euro gekauft, sondern „übernommen“. Ob das mit Hilfe der Polizei, der Armee oder der polnischen Geheimdienste geschah, ist nicht bekannt.
Bekannt ist hingegen, dass die deutschen Eigentümer händeringend nach einem Käufer suchten, um weitere schmerzliche finanzielle Verluste zu vermeiden, und dass sie in Anbetracht dessen ein gutes Geschäft gemacht haben. Andere Offerenten, abgesehen von Orlen, gab es nicht. Ohne den Kauf hätten die Deutschen die Blätter eines nach dem anderen eingestellt. Knapp 2.500 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel und wurden gerettet. Dass seit Mitte der Neunzigerjahre praktisch ausnahmslos alle polnischen Regionalzeitungen einem deutschen Konzern gehörten und von ihm politisch linksliberal gleichgeschaltet waren, hat die RoG nie gestört.
Das Gleiche gilt für den Gesetzentwurf zur Regelung der Anteile von Nicht-EU-Kapital an polnischen Medien, was z. B. in Frankreich längst beschlossen wurde. Schon das Erscheinen des Entwurfs wurde als Bedrohung der Meinungsfreiheit bewertet. Die Tatsache, dass das Gesetz aufgrund des normalen demokratischen Prozesses (Veto des Präsidenten) gescheitert ist, beweist für die RoG nichts. Denn was für eine Freiheit ist das, wenn solche Projekte überhaupt entstehen?
Auch wird das Arbeitsverbot für Journalisten im polnischen Grenzgebiet zu Weißrussland erwähnt, nachdem Diktator Lukaschenka begonnen hatte, massenweise Migranten für teures Geld nach Minsk einzufliegen. An die Grenze gekarrt, wurden sie dann zum gewaltsamen Stürmen der polnischen Grenzanlagen angestachelt. Als Aktivisten, Oppositionspolitiker und einige Journalisten begannen den Grenzzaun einzureißen, die Grenzpolizei bei ihrer Arbeit massiv zu provozieren und zu behindern, musste eine No-Go-Zone entlang der Grenze her.
Diese Umstände werden von RoG genauso wenig erwähnt wie die Tatsache, dass die meisten polnischen Medien sechs Monate lang über nichts anderes Horrorberichte verfassten, als über die gefühllose Haltung des Staates gegenüber den Lukaschenka-Migranten. Weil Polen ein freies Land ist und jeder schreibt, was er will.
Es gibt auch Anschuldigungen, dass Gesetze seit dreißig Jahren nicht geändert wurden. Da wird z. B. die Beleidigung bestimmter Institutionen mit einer Gefängnisstrafe geahndet. Doch es ist totes Recht, da es nicht angewendet wird. Es stimmt, dass öffentlich-rechtliche Medien Werbeaufträge von der öffentlichen Hand erhalten, aber das war auch schon vor zehn oder zwanzig Jahren so und hat die RoG damals nicht im Geringsten gestört.
Etwa 70 Prozent aller Medien in Polen verfolgen einen harten, unversöhnlichen Kurs gegenüber der nationalkonservativen Regierung. Dazu gehören die größten Tageszeitungen: „Fakt“, „Gazeta Wyborcza“, „Rzeczpospolita“, „Dziennik Gazeta Prawna“, die auflagenstärksten Wochenmagazine „Newsweek“, „Polityka“, „Angora“, „Tygodnik Powszechny“, der Fernsehsender TVN, alle großen Internetportale u. v. m.
Derweil residieren in Polen, dem Land, wo es angeblich kaum mehr Meinungsfreiheit gibt, der Agora-Konzern als Herausgeber der „Gazeta Wyborcza“ und deren Redaktion in einem prächtigen Büropalast mitten in Warschau. Agora hat 2021 Einnahmen in Höhe von umgerechnet ca. 76 Millionen Euro und einen Nettogewinn von ca. 6 Millionen Euro verbucht. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern keine Hemmungen, von der verhassten Recht-und-Gerechtigkeit-Regierung umgerechnet 5 Millionen Euro an Corona-Hilfen entgegenzunehmen.
Das Bild, das diese Medien Tag für Tag, Woche für Woche seit sieben Jahren von Polen zeichnen ist tiefschwarz. Politiker aus dem Regierungslager sind immer schlecht, gemein, zynisch und unfähig. Wenn sie Wahlen gewinnen, dann nur mit Lügen. Wenn ihre Politik „ausnahmsweise“ erfolgreich ist, dann nur durch Zufall oder weil sie ihre Ideen irgendwo geklaut haben. Angeführt werden sie von einem Kaczyński, dem Hitler, Stalin, Pol Pot und Putin nicht im Entferntesten das Wasser reichen können. Nichts funktioniert, wohin man blickt, herrscht Hoffnungslosigkeit, wohin man das Ohr wendet, da rasseln die Ketten.
Es sind ausnahmslos Reporter dieser Medien, die den Reportern ohne Grenzen über die Medienfreiheit in Polen Rapport erstatten. Im Jahr 2015 befand sich Polen auf der RoG-Liste auf Platz 18. Damals wie heute verkündet jeder in Polen, was er will, nur geschieht das jetzt unter der falschen Regierung.
RdP